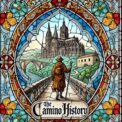Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Ein Ort des Glaubens im Wandel der Zeit
Die Kirche St. Mariä Geburt in Hürth-Efferen ist nicht nur ein architektonisches Meisterwerk, sondern auch ein lebendiges Zeugnis für die Geschichte und den Wandel der katholischen Gemeinde. Ihr Ursprung reicht bis ins frühe Mittelalter zurück, doch mehrfach wurde sie neu gebaut – zuletzt nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, als sie in den 1950er-Jahren nach einem revolutionären, modernen Konzept wiedererrichtet wurde.
Mit ihrer offenen Raumgestaltung, den eindrucksvollen Buntglasfenstern und der harmonischen Mischung aus historischen und modernen Elementen ist sie heute ein spirituelles Zentrum und eine architektonische Besonderheit. Besonders die Erweiterung in den 1970er-Jahren zeigt, wie die Kirche sich stetig an die wachsenden Bedürfnisse der Gemeinde angepasst hat.
Diese Dokumentation gibt einen detaillierten Einblick in die Geschichte, Architektur und Ausstattung dieser besonderen Kirche – von ihren romanischen Wurzeln bis zur modernen Erweiterung.
Die frühen Anfänge – Vom Hofgut zur Pfarrkirche
Die Geschichte von St. Mariä Geburt in Hürth-Efferen reicht tief in die Vergangenheit zurück. Bereits im frühen 8. Jahrhundert könnte an diesem Ort eine kleine Kirche existiert haben. Efferen gehörte zu den Besitzungen des Kölner Stiftes St. Maria im Kapitol, das Plektrudis, die Frau von Pippin dem Mittleren, im Jahr 696 gründete.
Die erste gesicherte Erwähnung von Efferen als Pfarrort stammt aus dem Jahr 1189, als Erzbischof Philipp I. von Heinsberg den Ort offiziell in die kirchliche Verwaltung des Erzbistums Köln aufnahm. Dies deutet darauf hin, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt eine eigenständige Pfarrei mit einem festen Gotteshaus existierte.
Doch die Kontrolle über die Kirche lag nicht bei der Gemeinde selbst: Im Jahr 1223 gliederte Äbtissin Gerbergis von St. Maria im Kapitol die Pfarrei formell in das Stift ein. Dies bedeutete, dass die Einkünfte der Pfarrei direkt nach Köln flossen und die Äbtissin auch den Pfarrer bestimmen konnte. Diese enge Verbindung zwischen Efferen und dem Kölner Stift bestand bis zur Säkularisation im Jahr 1803.
Die romanische Kirche (11. bis 19. Jahrhundert)
Die erste Kirche in Efferen war vermutlich eine schlichte Holzkirche, die später durch einen romanischen Steinbau ersetzt wurde. Die genaueren Baujahre sind nicht überliefert, aber vermutlich entstand die romanische Kirche zwischen dem 11. und 12. Jahrhundert (Einzelne Quellen reden sogar vom 8. Jahrhundert).
Die Kirche trug damals den Namen „Nativitas B.M.V.“ (Geburt der Seligen Jungfrau Maria). Die Bauweise war für eine romanische Dorfkirche typisch:
✔ Kirchenschiff mit schlichten Rundbogenfenstern
✔ Westturm mit kuppelförmigem Dach
✔ Abgetrennter Torraum mit Rundbogentor als Haupteingang
✔ Drei Altäre, gewidmet der Heiligen Walburga, der Jungfrau Maria und der Heiligen Anna
Diese Kirche diente den Gläubigen über 700 Jahre lang als Gotteshaus. Doch mit der Industrialisierung und dem Bevölkerungswachstum im 19. Jahrhundert wurde sie zu klein, sodass ein Neubau notwendig wurde.
Die neugotische Pfarrkirche (1869–1944)
Am 6. Juni 1869 wurde die romanische Kirche abgerissen und durch eine neugotische Saalkirche auf der gegenüberliegenden Seite der Kaulardstraße ersetzt. Die Pläne stammten vom Kölner Architekten Heinrich Nagelschmidt, und die neue Kirche bot Platz für etwa 800 Gläubige.
Merkmale der neugotischen Kirche:
✔ Dreischiffige Hallenkirche
✔ Spitzbögen und Maßwerkfenster
✔ Querhaus und Chorjoche
✔ Hoher Kirchturm mit gotischen Elementen
Die feierliche Einweihung fand durch Weihbischof Johann Anton Friedrich Baudri statt. Heute ist dies die Friedenskirche.
Die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg
Am 31. Oktober 1944 trafen schwere Bombenangriffe Hürth-Efferen, und die neugotische Kirche wurde fast vollständig zerstört. Nur wenige Überreste konnten gerettet werden, darunter Teile des alten Chorgestühls, das ursprünglich aus St. Maria im Kapitol in Köln stammte.
Nach der Zerstörung musste sich die Gemeinde in einer Notkirche behelfen, die auch von der evangelischen Gemeinde mitgenutzt wurde. Erst 1952 erhielt die evangelische Gemeinde ihre eigene Kirche, die heutige Friedenskirche in Efferen.
Die moderne Kirche St. Mariä Geburt (1956–heute)
Nach dem Krieg wurde der Wunsch nach einer neuen Kirche laut. Doch anstatt den alten Standort wieder aufzubauen, entschied man sich für eine Neugestaltung an einem neuen Ort – dem Gelände des ehemaligen Friedhofs an der Ecke Bachstraße / Kaulardstraße.
Die Architekten Wolfram Borgard und Fritz Volmer entwarfen einen modernen Bau, der den traditionellen Kirchenstil bewusst hinter sich ließ. Der neue Kirchenbau wurde am 25. November 1956 durch Weihbischof Wilhelm Cleven geweiht.
Architektur der Kirche St. Mariä Geburt in Hürth-Efferen
Ein moderner Neubau für eine wachsende Gemeinde
Nach der völligen Zerstörung der neugotischen Kirche im Zweiten Weltkrieg begann die Gemeinde in den 1950er-Jahren mit der Planung eines zeitgemäßen Neubaus. Die Kölner Architekten Wolfram Borgard und Fritz Volmer entwickelten ein Konzept, das sich deutlich von traditionellen Kirchenbauten unterschied.
Die neue Kirche wurde in den Jahren 1955–1956 errichtet, und ein Jahr später, 1957, folgte der Bau des freistehenden Glockenturms. Das Baumaterial bestand vor allem aus Stahlbeton, Ziegel und Glas, was eine schlichte, aber innovative Architektur ermöglichte.
Ein völlig neues architektonisches Konzept
Die Kirche St. Mariä Geburt brach mit den klassischen Formen des Sakralbaus und folgte einem avantgardistischen Konzept, das bereits viele Elemente der späteren Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965) vorwegnahm:
✔ Stahlbeton- und Ziegelbauweise für eine moderne, reduzierte Ästhetik
✔ Flaches, scheinbar schwebendes Dach, das auf wenigen Stützpfeilern ruht
✔ Altar freistehend in der Mitte, um eine stärkere Beteiligung der Gemeinde zu ermöglichen
✔ Große Fensterflächen, die den Innenraum mit Licht durchfluten
Das Besondere an diesem Konzept war die bewusste Entscheidung, den Altarraum nicht mehr an die Wand zu setzen, sondern ihn umgehbar zu gestalten. Damit entstand eine offene und gemeinschaftliche Liturgieform, die sich erst Jahre später in der gesamten katholischen Kirche etablieren sollte.
Bauweise und Gestaltung des Turms
Der Glockenturm besitzt eine quadratische Grundfläche, sein Schaft besteht aus massiven Ziegelmauern.
🔹 Im oberen Bereich geht die Konstruktion in eine Glockengeschosszone aus Holzfachwerk über, die mit Schiefer verkleidet ist.
🔹 Die Turmfassade ist im unteren Bereich nur durch wenige kleine Fenster unterbrochen, während das Glockengeschoss mehrere schmale Öffnungen besitzt, die an Schießscharten erinnern.
🔹 An der östlichen Ziegelwand, die vor dem Umbau mit der Kirche verbunden war und heute durch eine Konche geschlossen ist, befindet sich ein Dreipass aus dem Maßwerk des Kölner Doms als dekoratives Element.
Umgestaltung des Turminneren
Der Innenraum des unteren Turmbereichs wurde zu einer kleinen Kapelle umgestaltet.
✔ Ein besonderes Highlight ist das große „Nazarener Kreuz“, das dort aufgestellt wurde.
✔ In das Glockengeschoss gelangt man über eine schmale Eisenleiter im Inneren des Turms.
Das Hauptgebäude – Funktionale Ästhetik und sakrale Architektur
Die Kirche selbst ist ein vielschichtiges Gebäude, das aus mehreren rechteckigen und ineinander verschachtelten Elementen besteht.
Außenfassade und Baumaterialien
Die gesamte Außenfassade ist, genau wie der Turm, aus roten Ziegelmauern errichtet.
🔹 Der Hauptteil der Kirche ist mit einem weit heruntergezogenen Dach mit 45°-Gefälle gedeckt.
🔹 Verschiedene Dachschrägen und Fensterelemente sorgen für ein dynamisches Erscheinungsbild.
Der Innenraum – Funktional und lichtdurchflutet
Der Innenraum wurde bewusst offen und flexibel gestaltet, um der Gemeinde einen zentralen, gemeinschaftlichen Ort des Gottesdienstes zu bieten.
✔ Im südlichen Bereich befinden sich mehrere funktionale Räume, darunter:
- Pfarrbüro
- Sakristei
- Pfarrbibliothek
- Ein kleiner Saal im Obergeschoss für ca. 130 Personen
✔ Das Herzstück des Kirchenraums ist das gewaltige Kreuz, das über dem wuchtigen Altar von der Decke herabhängt.
Die Erweiterung in den 1970er Jahren
Durch die stetig wachsende Gemeinde wurde die Kirche bald zu klein. Deshalb erfolgte 1971–1972 unter der Leitung des renommierten Kölner Architekten Karl Band eine Erweiterung des Gebäudes.
🔹 Erweiterung nach Osten:
- Verlängerung des südlichen Seitenschiffs um ca. 60 m²
- Orgel und Chor wurden auf eine obere Ebene verlegt, die auf Eisensäulen ruht
🔹 Erweiterung nach Westen:
- Die Westwand wurde um ca. 6 Meter zurückgesetzt
- 160 m² zusätzlicher Raum wurden geschaffen
- Sechs modern gestaltete Buntglasfenster sorgen für eine neue Lichtführung
Die besondere Gestaltung der Fenster
Ein wesentliches Element der Kirche St. Mariä Geburt sind die beeindruckenden Fensterfronten, die einen außergewöhnlichen Lichteinfall ermöglichen.
Die Nordseite – Betonwaben und Buntglasfenster
Die ursprüngliche Nordwand wurde von den Architekten Borgard und Volmer mit einer Betonwabenfensterfront gestaltet.
🔹 Diese enthielt Buntglasfenster mit Motiven aus der Lauretanischen Litanei.
🔹 In der Erweiterung von Karl Band wurden diese Fenster mit dunkelverfugten Ziegelsteinen ausgefüllt.
🔹 Zusätzlich wurde eine 3 Meter hohe, rautenförmige Lichtbetonwand eingefügt, die die dahinterliegende Beichtstuhlanlage mit Tageslicht versorgt.
Der Chorraum – Licht und Symbolik
Ein weiteres Highlight der Architektur ist der viereckige Chor an der Nordseite.
🔹 Ein 3 Meter hoher Lichtschacht lässt farbiges Licht durch die Verglasung in den Altarraum strömen.
🔹 Der Lichtschacht beginnt als schmale Spitze auf Höhe der Empore und erweitert sich nach Osten hin unter dem Dach.
🔹 So wird der gesamte Altarraum von einem symbolischen „himmlischen Licht“ durchflutet.
📌 Fazit:
Die Architektur von St. Mariä Geburt in Hürth-Efferen ist ein herausragendes Beispiel für die Verbindung von moderner Bauweise und sakraler Funktionalität.
🔹 Der Bau vereint Stahlbeton, Ziegel und Glas zu einem offenen, lichtdurchfluteten Gotteshaus.
🔹 Die radikale Neugestaltung des Altarraums und das scheinbar schwebende Dach machten die Kirche zu einer der fortschrittlichsten Sakralbauten ihrer Zeit.
🔹 Mit der Erweiterung von Karl Band in den 1970er Jahren erhielt die Kirche noch mehr Platz für eine wachsende Gemeinde.
Bis heute ist St. Mariä Geburt ein bedeutendes architektonisches Denkmal – sowohl für die Gemeinde als auch für die moderne Kirchenarchitektur im Rheinland.
Die farbigen Fenster – Licht als sakrales Element
Ein zentrales gestalterisches Element der Kirche sind die farbigen Fenster, die 1972/73 von dem Kölner Künstler Will Thonett geschaffen wurden.
🔹 Die Fenster sind nicht nur dekorativ, sondern verleihen dem Kirchenraum eine stimmungsvolle Atmosphäre, indem sie das Licht in farbige Reflexionen tauchen.
🔹 Besonders das Lichtband im Altarraum sorgt für eine sakrale Wirkung, die die Architektur unterstreicht.
🔹 Die Nordseite wurde ursprünglich mit Betonwabenfenstern gestaltet, die Motive aus der Lauretanischen Litanei zeigten.
Ein moderner Altar aus Aachener Blaustein
Der Altar von St. Mariä Geburt in Efferen ist ein zentrales liturgisches Element und wurde vom Kölner Bildhauer Bernhard Schoofs gestaltet. Er besteht aus massivem Aachener Blaustein, einem besonders dichten Kalkstein, der für seine dunkle Farbgebung und seine edle Anmutung bekannt ist. Der Altar ist schlicht gehalten, trägt jedoch an der Vorderseite eine stilisierte Darstellung zweier Engel, die auf das Sakrament der Eucharistie verweisen.
In der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965) wurde festgelegt, dass der Priester bei der Messe nicht mehr mit dem Rücken zur Gemeinde steht. Schon vor dieser Reform wurde in St. Mariä Geburt der Altar freistehend im Raum platziert, sodass er von allen Seiten umschritten werden kann – ein damals wegweisendes Konzept.
Das monumentale Kreuz über dem Altar
Direkt über dem Altar schwebt ein monumentales Hängekreuz, das sich durch seine außergewöhnliche Gestaltung von traditionellen Kruzifixen abhebt. Es wurde von Heinz Rheindorf entworfen und fügt sich harmonisch in die moderne Architektur der Kirche ein.
Besondere Merkmale des Kreuzes:
- Das Kruzifix ist aus Metall gefertigt und mit kunstvollen Reliefarbeiten versehen.
- An den vier Enden des Kreuzes befinden sich farbige Emaillearbeiten mit biblischen Darstellungen.
- Die Darstellung Christi ist ungewöhnlich: Der Körper ist schlank und ausdrucksstark modelliert, die Arme sind weit geöffnet – ein Symbol für die universelle Erlösung und die Einladung an alle Gläubigen.
- Die Rückwand aus roten Ziegelsteinen bildet einen starken Kontrast und hebt das Kreuz besonders hervor.
Das Kruzifix steht nicht nur für das Leiden und den Tod Jesu, sondern auch für die Auferstehung und die Hoffnung – eine Botschaft, die sich in der offenen und lichtdurchfluteten Architektur der Kirche widerspiegelt.
Liturgische Ausstattung – Blaustein als zentrales Material
Der Kölner Bildhauer Bernhard Schoofs gestaltete 1972 einen Großteil der liturgischen Ausstattung. Er verwendete dabei Aachener Blaustein, ein tiefgraues, fast schwarzes Gestein, das den Werken eine markante Wirkung verleiht.✔ Sedilien (Sitzgelegenheiten für Geistliche) – Diese sind bewusst schlicht gehalten, um die Konzentration auf den Gottesdienst zu lenken.
✔ Ambo (Lesepult für biblische Lesungen) – Ein monumentales Pult aus demselben Material, das optisch mit Altar und Taufstein korrespondiert.
✔ Tabernakelstele (Säule für das Sakramentshaus) – Auf dieser Stele ruht das Sakramentshaus, das 1972 von Heinz Rheindorf geschaffen wurde.
Das Chorgestühl – Ein wertvolles Relikt aus dem 16. Jahrhundert
Das älteste Inventarstück der Kirche ist das Chorgestühl im Nordbereich des Chores. Teile dieses kunstvollen Gestühls stammen bereits aus dem 16. Jahrhundert und wurden ursprünglich in der mittelalterlichen romanischen Kirche genutzt.
Herkunft & Bedeutung
✔ Ursprünglich gehörten die Chorstühle zur Kölner Kapitolskirche St. Maria im Kapitol, bevor sie in die Efferener Kirche übernommen wurden.
✔ Es handelt sich um Miserikordien (hochklappbare Sitze mit Schnitzereien auf der Unterseite).
✔ Im hochgestellten Zustand zeigen sich Wappen von Kölner Patrizierfamilien, die im Mittelalter oft das Bürgermeisteramt bekleideten.
✔ Identifizierte Wappen:
- Reihts
- Rinks
- Kannegießer
- Ein viertes Wappen, das möglicherweise den Overstolzen oder der Familie Lyskirchen zugeordnet werden kann.
Restaurierung & Rekonstruktion
Bis 1974 waren nur noch vier Sitzteile des Gestühls erhalten. Der Restaurator Karl Heinz Müller (Brühl) rekonstruierte es und ergänzte zwei weitere Sitze.
🔹 Die äußeren Sitze zeigen links die heutige Kirche St. Mariä Geburt und rechts die Kölner Stiftskirche St. Maria im Kapitol.
🔹 Dazwischen befinden sich erneut die Wappen der Patrizier, die als Stifter des Chorgestühls gelten.
Der Taufstein – Ein Kunstwerk des Glaubens
Ein einzigartiges Symbol für die Taufe
Der Taufstein in St. Mariä Geburt, Hürth-Efferen, ist nicht nur ein liturgischer Gegenstand, sondern ein kunstvoll gestaltetes Werk mit tiefgreifender Symbolik. Er wurde aus dunklem Aachener Blaustein gefertigt und mit kunstvollen Gravuren und Reliefs verziert.
Der Deckel des Taufbeckens
Besonders auffällig ist der bronzene Deckel des Taufsteins, der mit einem kunstvollen Relief versehen ist. Die plastische Darstellung auf der Spitze zeigt eine eindringliche Szene: Jesus als betende Figur mit zum Himmel erhobenen Händen, die ein schlichtes Tuch trägt. Diese Darstellung kann als Symbol für Johannes den Täufer oder als ein Symbol für die Menschheit verstanden werden, die in der Taufe von Sünde befreit wird. Die rundumlaufende Kette mit ihren ineinander greifenden Gliedern kann als Zeichen der Verbundenheit der Gläubigen im Glauben interpretiert werden.
Gravuren und Verzierung
Die Basis des Taufsteins ist mit wellenförmigen Gravuren geschmückt, die auf das Element Wasser hinweisen – das zentrale Symbol der Taufe. Ein weiteres eingraviertes Motiv zeigt eine stilisierte Arche Noah, ein altes Symbol für Rettung und Neuanfang.
Bedeutung für die Gemeinde
Der Taufstein ist nicht nur ein liturgischer Gegenstand, sondern auch eine künstlerische Reflexion über den Sinn der Taufe. Er erinnert daran, dass die Taufe ein Übergang ist – von der Dunkelheit zum Licht, von der alten zur neuen Existenz als Teil der christlichen Gemeinschaft.
Die Glocken – Klangvolle Zeugnisse der Geschichte
Der Glockenturm beherbergt fünf Glocken, die in einem dreistöckigen Stahlglockenstuhl hängen. Zwei der Glocken stammen noch aus den alten Kirchen und sind wertvolle Relikte der Vergangenheit.
Die Marienglocke (1474) – Ein Meisterwerk aus dem 15. Jahrhundert
Die größte und bedeutendste Glocke ist die Marienglocke von 1474.
✔ Sie trägt eine einzeilige Minuskelinschrift (mittelalterliche Kleinbuchstaben).
✔ Unterhalb der Inschrift befinden sich verschiedene Heiligenreliefs.
✔ Die Glocke hat eine besonders schwere Konstruktion, was ihr einen weichen, vollen Klang verleiht.
✔ Sie erklingt nur an Hochfesten und ruft die Gemeinde zu den besonders feierlichen Gottesdiensten.
Besonderheit: Die Glocke wird auch für das tägliche Angelusläuten genutzt. Dabei werden drei Mal drei Schläge ausgeführt, um an das Gebet des Engel des Herrn zu erinnern.
Weitere Glocken & Funktionen
Neben der Marienglocke gibt es vier weitere Glocken, die zu unterschiedlichen Anlässen geläutet werden:
✔ Die kleine Waldborchglocke – Sie wird ausschließlich solistisch verwendet.
✔ Die Anna-Glocke – Dient dem Viertelstundenschlag der Turmuhr.
✔ Die Josef-Glocke – Erklingt zur vollen Stunde.
📌 Fazit:
Die Ausstattung der Kirche St. Mariä Geburt in Hürth-Efferen zeigt eine gelungene Mischung aus modernen und historischen Elementen:
🔹 Die Buntglasfenster von Will Thonett bringen sakrales Licht in den Kirchenraum.
🔹 Der monumentale Altar und die liturgische Ausstattung von Bernhard Schoofs schaffen eine starke räumliche Wirkung.
🔹 Das Chorgestühl aus dem 16. Jahrhundert verbindet die Kirche mit ihrer langen Tradition.
🔹 Die Marienglocke von 1474 ist ein klangvolles Relikt aus der Vergangenheit.
Jede dieser künstlerischen und liturgischen Ergänzungen trägt dazu bei, dass die Kirche eine einzigartige Verbindung zwischen Geschichte und Moderne darstellt.
Einladung mehr vom Weg zu Entdecken
Hier findest du weitere passende Beiträge über Sehenswürdigkeiten auf der Via Coloniensis.
Bleibe informiert
Melde dich jetzt für meinen Newsletter an und bleibe stets auf dem Laufenden, welche Wanderung als nächstes ansteht. Der Newsletter wird in unregelmäßigen Abständen versendet und du kannst dich jederzeit über den Link wieder abmelden.
Unterstütze das Projekt
Dieses Projekt lebt von meiner Leidenschaft für die Pilgerwege und historischen Orte Europas. Um die Seite weiter ausbauen und pflegen zu können, freue ich mich über jede Unterstützung, die mir hilft, diese Inhalte für alle verfügbar zu machen. Mit deiner Hilfe kann ich auch weiterhin Pilgerwege dokumentieren und die schönsten Schätze für alle zugänglich machen.